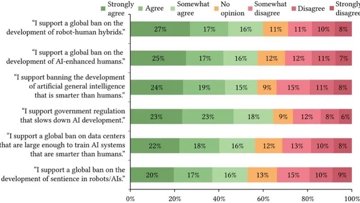Während Europa noch im Ausschuss sitzt, schraubt Tesla, Inc. bereits Roboter zusammen. Jüngste Einblicke in die Pilotproduktionslinie des humanoiden Roboters Optimus in Fremont, Kalifornien, haben eine hitzige Debatte über die wachsende Kluft zwischen amerikanischer Tatkraft und europäischer Bedenkenträgerei entfacht. Die Bilder von Humanoiden, die wie Autos am Fließband montiert werden, gepaart mit CEO Elon Musks jüngster Prognose, die Pilotlinie könnte jährlich bis zu einer Million Einheiten produzieren, stehen in krassem Gegensatz zum Labyrinth aus Regulierungsrahmen und Ethikkommissionen der EU.
Der Kommentar des Robotik-Insiders Ilir Aliu trifft den Nagel auf den Kopf: „Amerika und China bauen Roboter. Europa baut Ausschüsse.“ Seine Kritik unterstreicht eine wachsende Frustration in der europäischen Tech-Szene. Der Kontinent verfügt über Weltklasse-Talente, doch diese Talente werden zunehmend durch eine Kultur ausgebremst, die präventive Regulierung über iterativen Fortschritt zu stellen scheint. Das Kernproblem ist nicht mangelndes Können, sondern ein Mangel an Erlaubnis, dieses Können schnell einzusetzen, was eine selbst auferlegte Innovationsgrenze schafft.
Warum ist das wichtig?
Hier geht es nicht nur um Tesla oder einen humanoiden Roboter. Es ist eine Fallstudie in Echtzeit über divergierende Innovationsphilosophien. Die USA und China liefern sich ein Rennen mit hohem Einsatz um die Automatisierung und betrachten Robotik als kritische Infrastruktur für die zukünftige wirtschaftliche und industrielle Dominanz. Europa hingegen riskiert, sich selbst in die Irrelevanz zu regulieren. Indem es auf absolute Sicherheit und theoretische ethische Perfektion optimiert, könnte es am Ende zwar perfekt sicher sein, aber völlig abgehängt. Die Gefahr besteht darin, dass, während die einen die Zukunft bauen, die anderen damit beschäftigt sind, das Protokoll der Sitzung darüber zu verfassen, wie man sie bauen könnte.