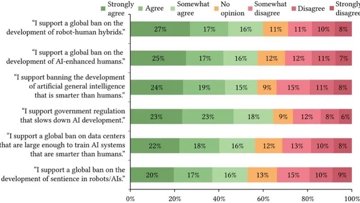Überblick
Im großen, klirrenden Theater der industriellen Automatisierung tragen nur wenige Namen die schiere Anziehungskraft von ABB. Dieser schwedisch-schweizerische Koloss ist kein mutiges Startup mit einem schicken Demovideo; er ist ein Grundpfeiler der modernen Fertigung. Die moderne ABB Group entstand 1988 durch die Fusion von ASEA aus Schweden und Brown, Boveri & Cie aus der Schweiz, doch ihre Robotik-Abstammung reicht weiter zurück. Ihr Vorgänger, ASEA, entfesselte bereits 1974 den weltweit ersten vollelektrischen, mikroprozessorgesteuerten Industrieroboter, den IRB 6.
Seit Jahrzehnten ist ABB die erste Wahl für jene schweren, präzisen und brutal zuverlässigen Roboterarme, die Autos bauen, Elektronik montieren und generell die langweiligen, schmutzigen und gefährlichen Aufgaben erledigen, die die Zivilisation am Laufen halten. Mit einer installierten Basis von über 500.000 Robotern ist ihr Einfluss unbestreitbar. Doch in einer Ära der agilen Cobots, KI-gesteuerten Flexibilität und des intensiven Wettbewerbs stellt sich die Frage, ob dieser Industrietitan so gut tanzen kann, wie er heben kann. Dieser Bericht taucht tief ein in die Technologie, Strategie und Marktposition eines Unternehmens, das die Regeln der Automatisierung mitgeschrieben hat und nun darum wetteifert, sie neu zu definieren.

Kernpunkte
- Gründungsgeschichte: Die moderne ABB entstand 1988, doch ihre Robotik-DNA begann 1974, als ihr Vorgänger ASEA den IRB 6, den ersten vollelektrischen, mikroprozessorgesteuerten Industrieroboter, auf den Markt brachte.
- Globaler Fußabdruck: Mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, beschäftigt ABB’s Geschäftsbereich Robotics & Discrete Automation über 11.000 Mitarbeiter in mehr als 53 Ländern.
- Marktposition: Ein globales Robotik-Schwergewicht, oft als einer der „Big Four“ neben KUKA, Fanuc und Yaskawa genannt. Es hält die globale Position #2 und ist die #1 in China, dem größten Robotikmarkt der Welt.
- Kernprodukte: Bekannt für sein umfangreichtes Portfolio an Industrierobotern (IRB-Serie), kollaborierenden Robotern (GoFa & SWIFTI), Delta-Robotern (FlexPicker) und Lackierrobotern.
- Software-Ökosystem: RobotStudio ist ein Eckpfeiler ihres Angebots und bietet leistungsstarke Offline-Programmierung und -Simulation, die es Kunden ermöglicht, Roboterzellen virtuell vor der Installation zu entwerfen und zu testen.
- Strategische Expansion: Erwarb ASTI Mobile Robotics im Jahr 2021 für gemeldete 190 Millionen US-Dollar, was einen wichtigen Einstieg in den boomenden Markt für Autonome Mobile Roboter (AMR) markierte.
- Installierte Basis: Hat mehr als 500.000 Roboterlösungen an eine Vielzahl von Branchen geliefert, darunter Automobil, Elektronik und Logistik.
Analyse
Geschichte und Entwicklung
ABBs Geschichte ist eine von strategischen Fusionen und einem unerbittlichen Fokus auf industrielle Stärke. Die Fusion von Schwedens ASEA und der schweizerischen BBC im Jahr 1988 schuf einen Giganten der Elektrotechnik. Die Robotik-Seele des Unternehmens wurde jedoch in den 1970er Jahren geschmiedet. ASEAs IRB 6 war nicht nur ein Roboter; er war eine Absichtserklärung, ersetzte klobige Hydrauliksysteme durch sauberere, präzisere Elektromotoren und ein Gehirn. Dieser Pioniergeist setzt sich mit Innovationen wie dem FlexPicker Delta-Roboter im Jahr 1998 fort, der das Hochgeschwindigkeits-Picken und -Packen revolutionierte.
Während die Grundlage in robusten Industrierobotern für Aufgaben wie Schweißen und Materialhandling liegt, war ABB gezwungen, sich zu entwickeln. Der Aufstieg der kollaborativen Robotik und flexiblen Fertigung drängte das Unternehmen zur Entwicklung seiner YuMi-, GoFa- und SWIFTI-Cobots. Jüngst war die Übernahme von ASTI Mobile Robotics im Jahr 2021 ein klares und teures Signal, dass ABB den Logistik- und Intralogistikbereich der Fabrikhallen nicht neueren AMR-Spezialisten überlassen würde. Dieser Schritt macht ABB zu einem der wenigen Unternehmen, das ein komplettes Portfolio von fest installierten Industrierobotern bis hin zu mobilen Robotern anbietet.
Technologie und Innovation
Im Herzen von ABBs Ökosystem liegt RobotStudio, eine Offline-Simulations- und Programmiersoftware, die wohl ebenso wichtig ist wie ihre Hardware. Sie ermöglicht Ingenieuren, eine gesamte Produktionslinie in einer virtuellen Umgebung aufzubauen und zu validieren – ein entscheidendes Werkzeug zur Minimierung von Ausfallzeiten und zur Risikominderung bei komplexen Automatisierungsprojekten. Dieser „Digital-Twin“-Ansatz, der auf einem virtuellen Controller basiert, der das reale Pendant identisch widerspiegelt, ist ein gewaltiger Wettbewerbsvorteil.
Auf der Hardware-Seite sind ABBs Roboter legendär für ihre Robustheit. Die IRB-Serie ist das Arbeitstier unzähliger Fabriken. Doch das Unternehmen verschiebt auch Grenzen. Seine OmniCore-Controller-Plattform ist flexibler und vernetzter konzipiert und bietet eine bis zu 25 % schnellere Leistung sowie einen geringeren Energieverbrauch. Im kollaborativen Bereich zielen GoFa und SWIFTI darauf ab, die Automatisierung für neue Benutzer zugänglich zu machen, mit einfacherer Programmierung und der Fähigkeit, Seite an Seite mit Menschen zu arbeiten. Und mit der ASTI-Übernahme verfügt ABB nun über ein vollständiges Portfolio an AMRs zur Automatisierung des Materialflusses, von der Produktion bis zur Logistik.
Marktposition
ABB operiert in der Stratosphäre der Robotikwelt. Es ist eine Standardwahl für groß angelegte industrielle Automatisierung, insbesondere im Automobilsektor. Seine Hauptkonkurrenten sind die anderen Industriegiganten: Fanuc, bekannt für seine Dominanz in Asien und extreme Zuverlässigkeit; KUKA, stark in Europa, besonders im Automobilsektor; und Yaskawa, ein weiteres japanisches Schwergewicht.
Die Stärke des Unternehmens liegt in seiner Größe, seinem umfassenden Portfolio und seinem globalen Servicenetzwerk. Wenn ein multinationales Unternehmen Hunderte von Robotern auf mehreren Kontinenten einsetzen möchte, steht ABB auf der Shortlist. Diese Größe kann jedoch auch eine Schwäche sein. Im dynamischeren Cobot-Markt steht es unter intensivem Druck von Spezialisten wie Universal Robots. Sein Schritt in den AMR-Markt bringt es in direkten Wettbewerb mit agilen Akteuren wie MiR und Locus Robotics. ABBs Herausforderung besteht darin, zu beweisen, dass es so agil wie mächtig sein kann, und sein weitläufiges Portfolio in eine kohärente, intelligente Automatisierungsplattform zu integrieren.
Fazit
ABB ist die unbestrittene Königsfamilie der Industrierobotik. Sie bauen die Maschinen, die die Welt bauen, mit einem Ruf für Qualität und Zuverlässigkeit, geschmiedet über ein halbes Jahrhundert. Ihre RobotStudio-Software ist eine Meisterklasse in der Schaffung eines Ökosystems, das Kunden bindet, und ihre massive installierte Basis bietet einen gewaltigen Burggraben. Für jeden großen Fertigungsbetrieb, bei dem ein Fehler keine Option ist, ist die Wahl von ABB eine Entscheidung, bei der niemand gefeuert wird.
Doch das Königreich wird belagert. Während ABB glaubwürdige Eintritte in Cobots und AMRs gemacht hat, holte es eher auf, als die Führung zu übernehmen. Die DNA des Unternehmens liegt in schwerem Metall und langen Produktionszyklen, eine potenzielle Fehlpaarung für die schnelllebige Welt der flexiblen, On-Demand-Fertigung. Ihre größte Herausforderung besteht nicht darin, bessere Roboter zu bauen – das beherrschen sie –, sondern eine kolossale Unternehmenskultur so zu verändern, dass sie wie ein softwaregetriebener, agiler Automatisierungspartner denkt und handelt.
Letztendlich ist ABB wie ein Schlachtschiff in einem Meer von Schnellbooten. Es ist immens mächtig, schwer bewaffnet, und man wäre ein Narr, in einem direkten Kampf gegen sie zu wetten. Aber ob es die engen, unberechenbaren Kanäle der modernen Automatisierung navigieren kann, ohne auf Grund zu laufen, bleibt die Milliarden-Dollar-Frage. Vorerst bleiben sie der Standard, an dem alle anderen Industrieroboter gemessen werden, auch wenn sich die Definition des „Industrieroboters“ unter ihren Füßen ändert.